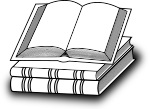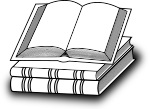
Tradition und Fortschritt verbinden
|

|
|
|
|
3.
Kapitel: Sozialpolitische Blockadeknoten
2. Schaubild: Sozialpolitische
Blockadeknoten
Das heutige Sozialsystem ist ein unüberschaubares Dickicht aus
Institutionen und Leistungen, in dem selbst Sozialbürokraten und
spezialisierte Anwälte
die Übersicht verlieren. Dabei krankt das System im Inneren an Problemen,
die durch seinen institutionellen Aufbau entstehen (endogene
Probleme, vgl. 2.1).
Nach außen leidet es unter einer mangelnden Reaktionsfähigkeit, um dem
Wandel im wirtschaftlichen Umfeld und der Gesellschaft adäquat zu begegnen
(exogene Probleme, vgl. 2.2 ). Diese Problemkomplexe
bedingen viele Ungerechtigkeiten (2.3 ). In der Summe kommt dies im
sozialpolitischen
Blockadeknoten zum Ausdruck, der die Akzeptanz und Legitimation der
Sozialpolitik in Frage
stellt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Institutionelle Probleme: Bürokratisierung, Ineffektivität, Intransparenz und Ineffizienz |

|
Gegensätzliche Ziele innerhalb ein und desselben
Sozialversicherungssystem: Vorsorge und Fürsorge Schon der Erfinder des Umlageverfahrens, Wilfried Schreiber, forderte eine
„radikale Unterdrückung von Staatszuschüssen zur Sozialversicherung“.
Heute werden die Rentenleistungen zu zwei Dritteln aus Beiträgen und zu
einem Drittel aus Steuern finanziert – eine problematische Vermischung der
Handlungsmaximen .
Ineffektivität durch unklare und mangelhafte Verteilung von Aufgaben
und Zuständigkeiten: Auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen bis hin
zur EU ist ein unübersichtliches Konglomerat an Institutionen entstanden,
die sich teilweise gegenseitig behindern. Oft ist ein sozialpolitischer
Verschiebebahnhof die Folge, Kosten der einen staatlichen Ebene werden auf
die andere überwälzt. So erfolgen einige der Konsolidierungsmaßnahmen im
Bundeshaushalt auf dem Rücken der Sozialversicherung.
Intransparenz: Je nach politischer Lage ändert sich die Sozialpolitik,
eine klare Linie ist nicht erkennbar. Die Bürger sind verunsichert, obwohl
die sozialen Sicherungssysteme eigentlich als Stabilisatoren der
Gesellschaft gedacht sind. So steigt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
die Sparquote, weniger Geld fließt in den Konsum – und die Krise
verschärft sich.
Ineffizienz: Die Komplexität der Sozialbürokratie führt zu enormen
Verwaltungskosten und ineffizienten Strukturen. So zählte die
„Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer“ (ASU) im Jahr 2005 2.197
Gesetze und 46.779 Einzelvorschriften, die der Gesetzgeber in Deutschland
erlassen hat. Sie unterliegen ständigen Änderungen und Ausbesserungen, was
zu einer Zersplitterung von Zuständigkeiten führt. Diese Entwicklung
betrifft auch die Sozialbürokratie, wobei die Kosten für die Verwaltung
immer weiter steigen.
|
3.2 Mangelnde Reaktionsfähigkeit
auf die Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft: Belastung des
Faktors Arbeit und Wegbrechen der Einnahmen |

|
Neben den endogenen institutionellen Problemen wird das Sozialsystem vor
allem durch exogene Einflüsse belastet. Volatiles wirtschaftliche Umfeld
sowie gesellschaftlicher Wandel führen zu hohen Belastung des Faktors
Arbeit und zum Wegbrechen von Einnahmen (Versicherungsbeiträge und
Steuern).
- Europäisierung und Globalisierung: Deutschland muss sich immer mehr dem
internationalen Kosten- und Steuerwettbewerb stellen, je stärker das Land in die
EU eingebunden wird, und die Globalisierung fortschreitet. Diese
„Globalisierungsfalle“ (Seeleib-Kaiser) führt zu Verlusten bei den
Steuereinnahmen und einem Beitragsrückgang für die Sozialversicherung. Hinzu
tritt die Problematik des „semi-souveränen Staates“ (Leibfried/Pierson) - immer
mehr sozialpolitische Kompetenzen werden an EU-Behörden abgegeben. Es entsteht
eine unklare Aufgabenverteilung zwischen Markt, Staat und Gesellschaft. Das gilt
auch für Bund, Länder und Gemeinden – eine Politikverflechtungsfalle (Scharpf,
1985) ist die Konsequenz: Verantwortlichkeiten vermischen sich, die vertikale
Gewaltenteilung wird geschwächt, und es kommt zu einer beschränkten
Handlungsautonomie der einzelnen Ebenen. In der EU sind die Interessengruppen
noch mehr verflochten, und die Macht der Lobbies ist groß – eine Entflechtung
der Systeme scheitert an ihrem Widerstand, weil sie ihren Einfluss nicht
aufgeben wollen.
- Technologische Entwicklungen: Die Produktivität ist in Deutschland enorm
gestiegen, zwischen 1948 und 1965 um 300 Prozent, zwischen 1970 und 1995 hat sie
sich verdoppelt. Das Rationalisierungspotential ist immer noch hoch. Die Folge:
Massenarbeitslosigkeit, ohne das ein Ende abzusehen ist. Diese Entwicklung
spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Investitionen, die deutsche
Unternehmen in den 90er Jahren tätigten: Etwa 40 Prozent aller Ausgaben
entfallen auf Rationalisierungsinvestitionen, Produktinnovationen und
Erweiterungsinvestitionen haben lediglich einen Anteil von 20-30 Prozent.
- Strukturwandel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft:
Immer mehr atypische Beschäftigungsmodelle außerhalb der Sozialversicherung
ersetzen das klassische Normalarbeitsverhältnis. Dabei wird oft die soziale
Absicherung vernachlässigt, soziale Segregation ist die Folge. So zahlen immer
weniger Erwerbstätige tatsächlich 45 Jahre in die Rentenversicherung ein.
Stattdessen kommt es zu Phasen von Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung,
Freisetzungen durch technologische Innovation sowie Arbeit in der
„Schattenwirtschaft“ oder auf Minijob-Basis.
- Konjunkturelle Schwankungen: Durch die Globalisierung der Märkte ist die
wirtschaftliche Entwicklung noch unberechenbarer geworden, ein stark elastisches
Arbeitsvolumen ist die Folge. Dadurch schwanken die Beitrags- und
Steuereinnahmen stärker – die Ausgaben für das Sozialsystem bleiben konstant
bzw. steigen in Krisenzeiten, während die Einnahmen sinken. Die klassischen
Konjunkturzyklen sind nicht mehr so ausgeprägt, was man an den rückläufigen
Wachstumsraten in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg erkennen kann.
- Überalterung der Bevölkerung: Durch den demographischen Wandel in der
Gesellschaft stehen immer weniger Steuer- und Beitragszahler immer mehr
Leistungsempfängern gegenüber. Laut Prognose des Bundesinstitutes für
Bevölkerungsforschung (BiB) wird sich die Bevölkerung in Deutschland bis 2050
auf etwa 75 Millionen verringern, selbst wenn jährlich 200.000 Menschen
zuwandern. Die über 60jährigen würden dann 37 % der Bevölkerung stellen.
- Hohe Belastung des Faktors Arbeit: Gegenwärtig werden etwa 42
% des Lohnes abgeführt. Dabei entfallen auf die Rentenversicherung 19,5
%, auf die Krankenversicherung zwischen 12 und 14,5 %. Die
Pflegeversicherung schlägt mit 1,7 % zu Buche, Kinderlose zahlen 0,25
Prozentpunkte mehr. Die Arbeitslosenversicherung macht 6,5 % des
Einkommens aus. Die hohe finanzielle Belastung eines jeden regulären
Arbeitsverhältnisses führt zu Beschäftigungen außerhalb der
Sozialversicherungssysteme und zur Abwanderung von Arbeitsplätzen in
Billiglohnländer Durch Schwarzarbeit wurden im Jahr 2003 schätzungsweise 370
Milliarden Euro erwirtschaftet, das entsprach 22,6 % des BIP. Die Folge: Dem
deutschen Sozialsystem gehen wichtige Einnahmen verloren.
- Konzentration auf den Lohn: Es gibt nicht nur eine hohe,
sondern auch eine einseitige Belastung des Faktors Arbeit, andere
Einkommensarten bleiben in der Regel unberücksichtigt, geringe Einnahmen
durch Konzentration auf den Lohn. Um Steuern und Versicherungsbeiträge
zu berechnen, werden fast ausschließlich Löhne und Gehälter
herangezogen, während sonstige Einnahmen nicht berücksichtigt werden.
Beispiel Krankenversicherung: Bürger mit hohen Einkommen und bester
Gesundheit werden von diesem solidarischen System nicht erfasst. Denn in
der gesetzlichen Krankenversicherung besteht eine „Solidarität der
Schwachen“ – Besserverdienende, Beamte und Selbstständige können sich
privat versichern.
- Pluralisierung individueller Lebenslagen und Lebensverläufe: Die
gesellschaftlichen Leitmotive haben sich gewandelt. War das Lebensmotto zu
Bismarcks Zeiten noch „Lebe, um zu arbeiten“, so heißt die Maxime heute:
„Arbeite, um zu leben“. Angesichts des materiellen Wohlstands tauchten
Selbstentfaltung, Lebensqualität und Identitätssuche als neue Ziele auf. Trotz
dieser Individualisierung begannen aber auch immer mehr Menschen, die
finanziellen Spielräume im Sozialsystem auszunutzen. So entstand eine gewisse
Bequemlichkeit und Aufgabe der Eigenverantwortung.
- Elastische Arbeitsnachfrage, Veränderung von Erwerbsbiographien:
Bedingt durch interne wie auch externe Einflüsse werden immer mehr
normale Arbeitsplätze durch atypische Beschäftigungsmodelle außerhalb
der Sozialversicherung ersetzt. Dies erfordert Flexibilität von Seiten
des Arbeitnehmers und führt zu starken Veränderungen in den
Erwerbsbiographien. Die Gruppe der Freiberufler, Ein-Euro-Jobber,
Ich-AGler und Mini-Jobber können zwar flexibel auf das Arbeitsangebot
reagieren, müssen sich aber auf dünnes Eis begeben und vernachlässigen
die eigene Absicherung oder können diese nicht bezahlen. Sie werden von
der Sozialversicherung fast gänzlich ausgeschlossen (soziale
Segregation).
- Entwicklung der Vermögens- und Einkommensverteilung: Die Umverteilung von oben
nach unten gelingt nicht. In der „Winner-take-all-Gesellschaft“ (Frank, Robert
H./Cook, Philip J.) werden die Reichen reicher, die Armen ärmer. Das zeigt auch
der zweite „Armuts- und Reichtumsbericht“ der Bundesregierung: Zwar nahm das
Nettogesamtvermögen zwischen 1998 und 2003 um 17 Prozent zu und beträgt
inzwischen fünf Billionen Euro. Aber dieses gewaltige Vermögen verteilt sich
extrem ungleich auf die Menschen in Deutschland: Die reichsten zehn Prozent der
Haushalte verfügen über 46,8 Prozent des Vermögens, wobei seit 1998 noch 2,4
Prozentpunkte hinzugekommen sind. Ganz anders das Bild bei den unteren 50
Prozent aller Haushalte: Ihr Anteil am Gesamtvermögen hat sich auf 3,8 Prozent
weiter verringert.
- Prekariat: diskontinuierliche, atypische, prekäre
Arbeitsverhältnisse - Abnahme der Normalarbeitverhältnisse,
Scheinselbständigkeit, Soziale Frage im 21. Jahrhundert: Feudale Klassenstruktur innerhalb
der Beschäftigten.
Flexibilisierung, Heterogenisierung und Entgrenzung
- Grenzen der Monetarisierung in der
Wissensökonomie. So arbeiten Millionen von Menschen an der Weiterentwicklung
des Internets, dadurch dass sie Inhalte erstellen oder Software
entwickeln, damit Geld verdienen ist aber sehr schwierig.
|
3.3 Ungerechtigkeiten |

|
Die oben aufgeführten exogenen und endogenen Probleme führen zu
Ungerechtigkeiten, wodurch die Legitimation und Akzeptanz der sozialen
Sicherungssysteme immer wieder in Frage gestellt wird. Leistungsüberschneidungen
und Leistungslücken kennzeichnen das soziale Sicherungssystem: Auf der einen
Seite gibt es Möglichkeiten des Missbrauchs (Trittbrettfahrer), auf der anderen
Seite fallen immer mehr Bürger durch das soziale Netz. Außerdem gibt es noch
folgende endogene Probleme, die Ausdruck des sozialpolitischen Blockadeknotens
sind:
- Ungerechte Lastenverteilung: Ungerechtigkeiten hinsichtlich der
Umverteilungswirkung: Leistungsüberschneidungen als auch Leistungslücken,
Armutsfalle, Besserstellung von Bedürftigen innerhalb der
Krankenversicherung und der Rentenversicherung (Grundsicherung für über
65jährige).
- Einseitige Belastung des Arbeitseinkommens. Als
Berechnungsgrundlage für die Sozialversicherung dient fast ausschließlich
das Arbeitseinkommen. Andere Einkünfte, wie Mieteinnahmen und
Kapitalerträge bleiben weitgehend unberücksichtigt. Das führt dazu, dass
diejenigen, die aufgrund eigener Reserven auf staatliche Unterstützung
verzichten könnten, trotzdem Leistungen erhalten.
- Keine gerechte Lastenverteilung, die Sozialversicherungssysteme
tragen
neben dem Steuersystem zur Ausbeutung der Familie bei - Kinder als
Armutsgrund. Kinderlose mit normalen Arbeitsverhältnis werden bevorzugt
und Eltern mit Kinder sowie Arbeitnehmer mit atypischen
Arbeitsverhältnissen sind die Verlierer im System. Vor Einführung der
Sozialversicherung ging es demjenigen schlecht, der keine Kinder hatte.
Heute spart sich reich, wer keine Kinder hat, denn Kinderlose mit normalem
Arbeitsverhältnis werden gegenüber Familien sowohl bei der
Sozialversicherung als auch bei den Steuern bevorzugt. Im Steuerrecht und
bei der Sozialversicherung werden Arbeitnehmer ohne Kinder gegenüber
Familien bevorzugt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem so
genannten „Trümmerfrauenurteil“ vom 7. Juli 1992 festgestellt: "Die
Familie, in der ein Elternteil zugunsten der Kindererziehung aus dem
Erwerbsleben ausscheidet, nimmt im Vergleich zu Kinderlosen nicht nur
Einkommenseinbußen hin, sie muss das gesunkene Einkommen vielmehr auch auf
mehrere Köpfe verteilen. Wenn die Kinder in das Erwerbsleben eingetreten
sind und durch ihre Beiträge die Alterssicherung der Elterngeneration mit
tragen, haben die Eltern selbst eine geringere Rente zu erwarten.“
- Demographisches Gleichgewicht zerstört,
Leben auf Kosten zukünftiger Generationen, Umlageverfahren und
unterschiedliches wirtschaftliche Umfeld führen zur Benachteiligung von
zukünftigen Generationen.
- Moral-hazard-Verhalten: Viele Menschen leben auf Kosten der Solidargemeinschaft,
obwohl sie im eigentlichen Sinne nicht bedürftig sind. Nur selten machen diese
Fälle Schlagzeilen, wie im Fall von „Florida-Rolf“, der tagelang die
Boulevard-Presse beschäftigte. Fälle wie dieser führen dazu, dass auch
tatsächlich Bedürftige als Sozialbetrüger abgestempelt werden und dadurch keine
Akzeptanz in der Gesellschaft finden. Die Wurzeln des Problems liegen in der
Unübersichtlichkeit des Systems, das Missbrauch und Trittbrettfahrertum
begünstigt.
- Inverse Solidarität: Armut steigt NACH Transferleistungen,
Umverteilung von unten nach oben. Nur 26,35 % der Umverteilung erreicht
die tatsächlich Bedürftigen, 65,78 % der Umverteilung geht von der linken
in die rechte Tasche, teilweise führt gerade diese Umverteilung von unten
nach oben und zu einer Benachteiligung der Familien mit Kindern. Die Umverteilung von oben nach unten gelingt nicht,
vielmehr findet eine Umverteilung von unten nach oben statt. Oder anders
formuliert: Die Schwachen tragen die Starken. Trotz immenser Ausgaben für
soziale Sicherung sind Hunderttausende von Menschen obdachlos, und weitaus mehr
leben unter der Armutsgrenze. Die „Europäische Kommission“ ließ für die 90er
Jahre untersuchen, wie sich Sozialtransfers auf einzelne Gruppen in der
deutschen Bevölkerung verteilen: Die ärmsten 20 Prozent erhielten 18 Prozent der
Transfers, die mittleren 60 Prozent kamen auf einen Anteil von 58 Prozent und
die reichsten 20 Prozent hatten mit 24 Prozent einen größeren Anteil, als man
bei ihrem Bevölkerungsanteil erwarten würde.
- Bevorzugung und Subventionierung von etablierten
Interessengruppen. Zu hohe Subventionierung von
bestimmten Gruppen (arbeitsfähige Personen und Rentner). Rentner werden, obwohl es
Altersarmut kaum mehr gibt, nicht genügend an den Gesundheitskosten
beteiligt. Strukturelle Benachteiligung von nicht bzw.
schwach organisierten und wenig konfliktfähigen Gruppen gegenüber etablierten
Interessengruppen. Spitzenverdiener nicht in der Krankenversicherung. Die meisten staatlichen Zuschüsse fließen in
die Rentenversicherung. Ein Drittel davon (ca. 80 Mrd. Euro) wird aus Steuern
finanziert. Von der Rentenversicherung profitieren jedoch insbesondere Menschen,
die ein normales Arbeitsverhältnis hatten und deshalb kaum auf staatliche
Unterstützung angewiesen sind. Außerdem werden Rentner nur zur Hälfte an ihren
Gesundheitskosten beteiligt, obwohl es Altersarmut kaum mehr gibt. Das „Institut
für Wirtschaft und Soziales“ (WISO) hat ausgerechnet, dass im Jahr 2000 die
erwerbstätigen Krankenversicherten die Rentner mit 62 Milliarden DM
subventioniert haben.
- Leistungsmissbrauch und zu hohe Unterstützung für arbeitsfähige Personen:
Seit
Einführung des Arbeitslosengeld II werden erwerbsfähige Personen zwar nur
begrenzt unterstützt. Weil es aber keine Mindestlöhne gibt, ist
Leistungsmissbrauch weiterhin möglich. Denn Mindestlöhne könnten die Aufnahme
von Arbeit attraktiv machen: So betrug der niedrigste tarifliche Stundenlohn in
Ostdeutschland 2003 2,74 Euro; auch in vielen westdeutschen Tarifverträgen gab
es Lohngruppen, in denen die Stundenlöhne unter sechs Euro lagen. Ein
Mindestlohn könnte dazu beitragen, dass der Abstand zwischen geringem Einkommen
und Sozialleistung zunimmt – und damit ein Anreiz entsteht, Arbeitslosigkeit zu
beenden. Außerdem wäre es sinnvoll, den Steuerfreibetrag zu erhöhen: Liegt er
deutlich über dem Existenzminimum (+10 Prozent), zahlt sich Arbeit eher aus.
Schließlich sollten arbeitsfähige Personen gemeinnützige Arbeit leisten - als
Gegenleistung für finanzielle Unterstützung. Leistungsmissbrauch und zu hohe
Unterstützung für arbeitsfähige Personen (Grundsicherung, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe),
Abstand zu Arbeitseinkommen ist oft nicht gegeben.
- Soziale Segregation: In Deutschland bilden sich neue Ungleichheitsstrukturen,
von einer „Spaltung der Stadt“ ist die Rede: 10 bis 20 Prozent der
Großstadtbevölkerung leiden unter Einkommensarmut, die Zahl der
Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslosen steigt. Im Gegensatz zu
traditionellen Formen der Armut hat dieser Ausgrenzungsprozess zur Folge, dass
für die betroffenen Haushalte der Abstand zu den durchschnittlichen Standards
der Lebensführung immer größer wird. Hartmut Häußermann stellt fest: „Der
Ausgrenzungsprozess erreicht seinen Höhepunkt, wenn Individuen oder Haushalte
(…) weit von der Mitte der Gesellschaft entfernt sind, und wenn dies mit einer
‚inneren Kündigung’ gegenüber der Gesellschaft zusammentrifft, die sich in
Resignation, Apathie und Rückzug äußert“ (Häußermann:
http://www.bpb.de/publikationen/DUX6L3,0,Die_Krise_der_sozialen_Stadt.html).
Ergebnis:
Die steigenden Finanzierungsprobleme zeigen es: Mit dem bestehenden
"Schönwettersystem", das in Zeiten der Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung
entstanden ist, kann auf die heutigen Gegebenheiten nicht adäquat reagiert
werden. Sowohl endogene als auch exogene Probleme des Sozialsystems führen dazu,
dass die Handlungsmaximen (Leitlinien, Ziele und Prinzipien) der Gesellschaft
und der sozialen Sicherheit verletzt werden. Ungerechtigkeiten sind die Folge,
was zu sinkender Akzeptanz und Legitimation der Sozialpolitik führt und so die
Gefahr der politischen Instabilität erhöht.
|